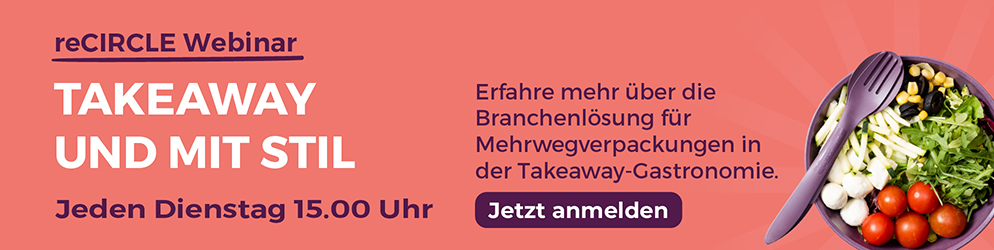Philippe Lathion, der während 20 Jahren das Seilbahnunternehmen Télénendaz führte, schafft mit Ferien-Resorts in der Schweiz ein neues Geschäftsmodell, das Investoren und Gäste anziehen kann und damit Hoffnungen für den alpinen Ferientourismus in der Schweiz weckt. Erste Projekte eines 2014 lancierten Investitionsfonds stehen vor dem Abschluss: Im Dezember wird in Vercorin eröffnet, 2018 folgen zwei Resorts in Zinal. Zudem kaufte eine Investmentgesellschaft kürzlich den bereits bestehenden Ferienkomplex in Brigels im Kanton Graubünden. Weitere Investitionen für zukünftige Bauten sind ausserdem im Wallis, in den Waadtländer Alpen, in Graubünden und im Berner Oberland vorgesehen. Begegnung mit einem Avantgardisten.
GastroJournal: Wie präsentiert sich die touristische Situation in der Schweiz?
Philippe Lathion: In den letzten zwanzig Jahren haben die Übernachtungen bei uns generell klar abgenommen, während sie bei unseren Nachbarn im gleichen Zeitraum konstant blieben oder sogar anstiegen. In der Regel wird der starke Franken für diesen Rückgang verantwortlich gemacht. Doch dieses Problem existiert nicht bereits seit zwanzig Jahren, sondern begann erst vor fünf Jahren. Alle Schwierigkeiten der Klimaerwärmung oder der Alterung der Bevölkerung in die Schuhe zu schieben, ist auch nicht richtig, denn die Bedingungen sind etwa in Frankreich oder in Österreich dieselben.
Was läuft also in der Schweiz nicht rund?
Wir haben viele Zweitwohnungen für Eigentümer gebaut, aber nicht genug strukturierte touristische Betten für Feriengäste. Deshalb sind ein Grossteil aller verfügbarer Betten für Touristen eigentlich Zweitwohnungen, die von den Eigentümern vermietet werden – Betten also, die nicht standardisiert und irgendwo in einer Station zerstreut sind. Eine solche
«Eigentümer haben nicht dieselben Interessen wie Feriengäste»Ansammlung unterschiedlichster Wohnungen darf nicht mit einem organisierten touristischen Komplex wie einem Feriendorf, einem Resort oder einem Hotel verwechselt werden, denn ein Eigentümer und ein Feriengast haben nicht die gleichen Bedürfnisse. Der Erstgenannte kennt die Destination bereits. Für ihn, der sich jedes Jahr für die Saison einrichtet, ist es ein Leichtes, seinen Skipass bei den Seilbahnen zu kaufen oder seine Einkäufe zu erledigen. Der Tourist hingegen hat nur eine Woche, um die Angebote der Destination kennenzulernen. Er will demzufolge keinen Tag verlieren, um seinen Skipass zu lösen, seine Kinder in der Skischule anzumelden, Material zu mieten und seinen Kühlschrank zu füllen. Sein Aufenthalt muss ihm von A bis Z organisiert werden. Und hier kommt der Tourismuskomplex ins Spiel, der den Gästen eine Rezeption und zahlreiche Dienstleistungen bietet. Unser bisheriges Tourismusmodell leidet unter einem strukturellen Problem, sprich zu viele kalte Betten oder nicht ausreichend warme Betten, wie auch insbesondere unter organisatorischen Schwierigkeiten beim Gästeempfang. Die Lex Weber zielt demzufolge in die richtige Richtung…
Das Verhältnis von Wohnungseigentümern und Feriengästen sind ein Problem, das jedes Land betrifft. Jedes findet hierfür jedoch Lösungen. Österreich führte vor Jahren bereits eine Beschränkung ein und verfügt heute über weniger als 10 Prozent Zweitwohnungen. Frankreich seinerseits versuchte, die touristischen Hotelanlagen zu fördern, anstatt Zweitwohnungen zu verbieten – es braucht auf jeden Fall beide. Heute gibt es im Wallis viele Zweitwohnungen. Die Lex Weber hat – zu Recht oder zu Unrecht – ein Korrektiv eingeführt. Dies beschleunigt Überlegungen, die man schon lange hätte anstellen sollen: Unterkünfte schaffen, die den Feriengästen eine richtige Dienstleistung bieten. Welche Lösungen gibt es, um dieser Nachfrage nachzukommen?
Die Angebote von Hotels oder Resorts müssen gefördert werden. Die touristischen Hotelanlagen sind hauptsächlich für Familien bestimmt. Die vollständig ausgestatteten Wohnungen befinden sich in der selben Hotelstruktur und verfügen über eine gewisse Anzahl gemeinsamer Dienstleistungen. Ferien-Resorts, wie Sie sie zurzeit realisieren?
Ja, aber wir erfinden nichts Neues. In Österreich gibt es schon lange Hotelkomplexe, welche die Vermietung von Zimmern und Wohnungen koppeln. Die Franzosen sind mit dem Bau von grossen Ferienanlagen ein bisschen dem Gigantismus verfallen. Ich meinerseits möchte eine Kette von Ferienunterkünften im Schweizer Alpenbogen schaffen, mit ungefähr 500 Betten pro Komplex. Diese Grösse ist notwendig, um gemeinsame Strukturen wie die Rezeption gewinnbringend betreiben zu können. Woher nehmen Sie die Gewissheit, dieses Modell sei erfolgversprechend?
Es besteht hierfür eine starke Nachfrage seitens der Reiseveranstalter. Ausserdem gehe ich davon aus, dass Touristen der Mittelklasse in der Schweiz und in Europa von einem kompletten Service, der im Preis inbegriffen ist, gerne Gebrauch machen würden.
«Ein Programm zum Aufkauf von Zweitwohnungen starten»Eine klare Konkurrenz zur Hotellerie also…
Nein, denn unsere Zielgruppe sind Familien. Dieses Angebot konkurriert nicht mit den Hotels, die in der Regel teurer und besser geeignet für kurze Aufenthalte, für Paare oder für Alleinreisende sind. Übrigens entscheiden sich zahlreiche Personen, die während Jahren Resorts bevorzugten, für einen Hotelbetrieb, sobald die Kinder gross sind. Hätte man nicht besser die bereits bestehenden Hotels erneuert?
Renovieren ist teurer als neu bauen. Man müsste ein gross angelegtes Programm zum Aufkauf von veralteten Zweitwohnungen starten. So könnten diejenigen, die ein Hotel bauen oder renovieren möchten, eine Serie übernehmen, sie auf den neuesten Stand bringen und sie dann mit einer Marge verkaufen, die ihnen das nötige Eigenkapital einbringt, um Hotels zu bauen oder zu renovieren. Auf diese Weise nimmt die Zahl an Zweitwohnungen nicht zu, während gleichzeitig neue Hotels entstehen. Ihre ersten Projekte realisierten Sie im Wallis, doch damit noch nicht genug. Bedeutet dies, Ihr Konzept ist im ganzen Land anwendbar?
Zuerst dachte ich, dass wir, die Walliser, die schlechten Schüler des Landes seien, da wir zahlreiche Zweitwohnungen bauten. Doch letztlich ist diese Problematik überall spürbar. Insbesondere die weniger bekannten Destinationen sind davon betroffen. Die Anzahl an Wohnungseigentümern ist gross, doch es stehen nur wenige Betten zur Verfügung, um viele Feriengäste aufzunehmen. Welche Organisationen investieren in Ihre Projekte?
In erster Linie die Pensionskassen. Diese Unternehmen haben langfristige Visionen. Sie sind an einer regelmässigen Rendite interessiert und werden so in der Tourismusbranche fündig. Inwiefern profitiert die lokale Wirtschaft davon?
Für den Bau der Gebäude werden hauptsächlich Unternehmen aus der Gegend beauftragt. Für den Komplex in Vercorin rechnen wir beispielsweise mit 70 000 Übernachtungen pro Jahr. Bekanntlich gibt ein Gast mindestens 100 Franken pro Tag aus, – das entspricht folglich 7 Millionen Franken, die in die Kassen der Destination einfliessen. Zudem werden die Tourismusanbieter immer neue Gäste finden, die Interesse an den gebotenen Aktivitäten zeigen.
«Man müsste aufhören, aufeinander eifersüchtig zu sein»Sehen Sie sich als Retter des helvetischen Tourismus?
Überhaupt nicht. Mich interessiert der unternehmerische Aspekt. Ich möchte die Idee, die mich antreibt, zu Ende bringen. Um den Tourismus zu retten, müsste man damit aufhören, aufeinander eifersüchtig zu sein und sich intern zu konkurrenzieren, denn die eigentliche Konkurrenz kommt von aussen, mit Flugtickets-Angeboten von EasyJet für eine 49-Euro-Reise nach Barcelona. Wir sollten viel solidarischer sein. Die Politiker ihrerseits müssten Rahmenbedingungen schaffen, um den Tourismus zu unterstützen. Der Föderalismus hat einen Nachteil: die Langsamkeit. Veränderungen werden so oftmals gebremst. Auch scheitern wir an den Vorschriften. Wenn ein Österreicher ein Baugesuch für ein Hotel auf 2700 Metern einreicht, bekommt er es. Wir hingegen könnten darauf noch lange warten.